Quellenangabe und Fußnoten - so geht es richtig
Nach einer erfolgreichen Recherche gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse in deinem Text zu verarbeiten. Ob Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Sachbuch oder Fachbuch – früher oder später greifst du auch auf das Wissen anderer Personen zurück. Eine saubere Quellenangabe ist hierbei wichtig, damit deutlich wird, woher du dein Wissen beziehst. Um korrekt zu zitieren, musst du einige Aspekte beachten. Wir haben für dich die wichtigsten Grundlagen zur Quellenangabe zusammengetragen!
Inhaltsverzeichnis
Warum muss ich Quellen angeben?
Als Autorin oder Autor eines Fachtextes hast du dir umfangreiches Wissen zu einem Thema angeeignet. Das gilt für die Bachelorarbeit wie für das Fachbuch. Doch niemand kann alles wissen, nicht einmal im Ansatz. Große Teile deines Wissens beruhen außerdem darauf, was andere vor dir erarbeitet haben. Daher greifst du auf das Wissen von Dritten zurück, beispielsweise frühere Studienergebnisse, Statistiken oder Theorien. Wenn in einem Fachtext nichts zitiert ist und keine Quellen angegeben sind, wirkt das nicht nur unseriös, es lässt auch berechtigte Zweifel aufkommen, ob der Text die nötige Substanz hat.
Die Textpassagen, die Fremdwissen enthalten, müssen mit Quellenangaben belegt werden. Unerlässlich ist die Nennung der Autorin oder des Autors. Geschieht dies nicht, begehst du ein Plagiat, du stiehlst also geistiges Eigentum Anderer. Das kann zu schwerwiegenden Konsequenzen führen, wie beispielsweise dem Nichtbestehen deiner schriftlichen Arbeit. Ein aktuelles berühmtes Beispiel stellt Annalena Baerbock dar, die derzeitige Bundesministerin des Auswärtigen Amtes. Über sie wurde im Jahr 2021 viel im Zusammenhang mit Plagiatsvorwürfen berichtet, da ihr vorgeworfen wurde, in ihrem Buch “Jetzt. Wie wir unser Land erneuern” abgeschrieben zu haben.
Wie gebe ich Buchquellen richtig an?
In der Wissenschaft existieren zahlreiche verschiedene Zitierweisen. Welche du in deinem Buch anwendest, kannst du für dich selbst entscheiden. Das Wichtigste ist, dass du den gewählten Stil im ganzen Buch beibehältst, d. h. die Quellenangabe immer auf die gleiche Weise erfolgt. Gegebenenfalls hat sich auch bereits auf deinem Fachgebiet eine bestimmte Zitierweise etabliert, auf die du zurückgreifen kannst.
Grundsätzlich wird zwischen sinngemäßen und wörtlichen Zitaten unterschieden:
Sinngemäßes Zitieren
Die Aussage eines Dritten wird in eigenen Worten wiedergegeben.
Wörtliches Zitat
Die Aussage eines Dritten wird unverändert in Anführungszeichen eingefügt.
Letztere solltest du nur sparsam einsetzen.
Weiterhin wird meist zwischen der amerikanischen und der deutschen Zitierweise differenziert:
1. Harvard-Zitierweise
Bei der amerikanischen Variante, auch Harvard-Zitierweise genannt, gibst du die Buchquellen in Klammern direkt im Text an:
– Sinngemäßes Zitat, Option 1:
Vor dem Lesen eines Buches weiß niemand, ob es ihm gefällt (Vgl. Mustermann 2010, S. 18).
– Sinngemäßes Zitat, Option 2:
Mustermann (2010, S. 18) behauptet, dass vor dem Lesen eines Buches niemand weiß, ob es ihm gefällt.
– Wörtliches Zitat:
“Niemand weiß, ob ihm ein Buch gefällt, bevor er es nicht gelesen hat” (Mustermann 2010, S. 18).
2. Deutsche Belegweise
Bei der deutschen Belegweise erfolgt die Quellenangabe hingegen in den Fußnoten einer Seite. Dazu wird im Text nach Satzende der entsprechenden Textstelle ein Fußnoten-Verweis eingefügt:
¹ Vgl. Mustermann (2010), S. 18.
² Mustermann (2010), S. 18.
Fußnoten
Fußnoten kannst du bei der Haravard-Zitierweise ausschließlich für ergänzende Anmerkungen verwenden, z. B. für kurze (!) Erläuterungen, weiterführende Literatur, Verweise auf andere Kapitel oder den Anhang. Längere Textpassagen gehören nicht in die Fußnoten!
¹ Vgl. Mustermann (2010), S. 18. Für eine kompakte Übersicht siehe auch Müller/Meyer (2012).
² Siehe hierzu auch Kapitel 3.4.
Wie Schreibprogramme helfen
Um Fußnoten zu erzeugen und diese automatisch zu nummerieren, kannst du die Fußnoten-Funktion deines Schreibprogramms verwenden. Wenn du Microsoft Word nutzt, gibt es zwei Arten, Fußnoten hinzuzufügen:
- Gehe an die Stelle, an der die Fußnote hinzugefügt werden soll.
- Gehe auf den Reiter “Einfügen” oben rechts und dann auf “Fußnote einfügen” links.
oder
- Klicke auch hier auf die Stelle, an der die Fußnote hinzugefügt werden soll.
- Gehe auf den Reiter “Referenzen” oben rechts und dann auf “Fußnote einfügen”, was kurz darunter zu finden ist.
Steht dir Pages bei Apple-Produkten zur Verfügung:
- Gehe an die Stelle, an der die Fußnote hinzugefügt werden soll.
- Gehe auf den Reiter “Einfügen” oben rechts und dann auf “Fußnote”, was weiter unten zu finden ist.
Fußnoten sind jedoch nicht zu verwechseln mit Endnoten, die am Ende des Dokuments oder Abschnittes angezeigt werden. Diese sind bei Microsoft Word direkt neben den Fußnoten zu finden. Bei Pages kann man sie nicht einzeln anklicken und auswählen, aber alle Fußnoten lassen sich in Endnoten umwandeln. Wurde eine Fußnote in dein Pages-Dokument eingefügt, klicke auf deine Quellenangabe am Ende der Seite und gehe dann zum Tab “Fußnoten” rechts bei “Format”. Dort kannst du unter “Typ” die Fußnote zu einer Endnote umformen.
Tipp: In einem anderen Artikel haben wir für dich die 5 besten Schreibprogramme verglichen.
Literaturverzeichnisse
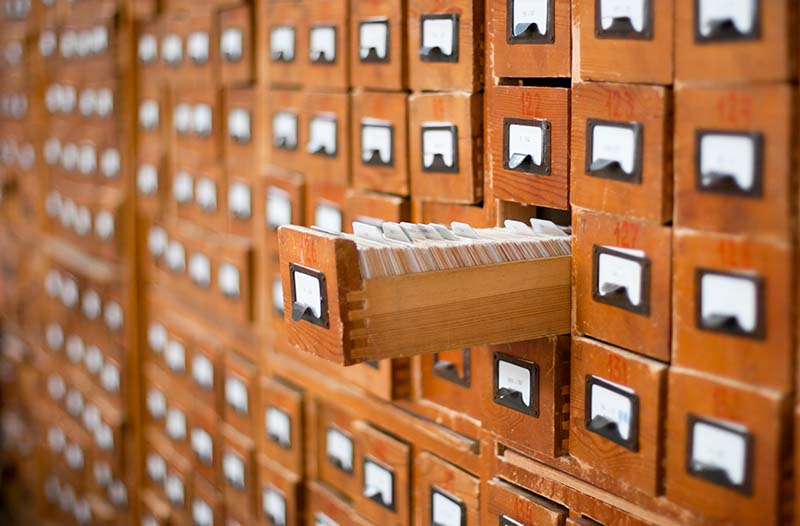
Alle im Text bzw. in den Fußnoten genannten Quellen musst du am Ende deines Buches ausführlich und nachvollziehbar in einem Literaturverzeichnis darstellen. Nur so können Leser*innen ihren Ursprung verfolgen und auf Wunsch etwas nachschlagen.
Wichtige Faktoren beim Verfassen eines Literaturverzeichnisses sind die Unterkategorien und die Anpassung an die unterschiedlichen Medien. Unterkategorien sollten beispielsweise erstellt werde, wenn neben gedruckten Quellen auch Internetquellen und Abbildungen verwendet wurden. Hast du verschiedene Medien genutzt, musst du auf die sich unterscheidenden Vorgaben achten. Lexika werden beispielsweise anders dargestellt als Zeitschriften.
Eine Buchquelle im Literaturverzeichnis sollte zudem mindestens folgende Angaben enthalten:
- vollständiger Name der Autoren und Autorinnen
- Titel und Untertitel
- Auflage (wenn es keine Erstauflage ist)
- Erscheinungsort
- Erscheinungsjahr
- Verlag
Nicht verwechseln! Buchquellen werden in den Fußnoten in kürzerer Form angegeben, um die Übersichtlichkeit im Text zu bewahren.
Weitere wichtige Hinweise für ein gelungenes Literaturverzeichnis:
- es wird im Inhaltsverzeichnis angegeben, aber nicht nummeriert
- Sortierung in alphabetischer Reihenfolge
- am Ende der Quellenangabe steht immer ein Punkt
- alle Autor*innen der Quelle angeben
- Vornamen ausschreiben
- gewählten Stil beibehalten
- gängige Abkürzungen verwenden
- Unterteilung in Primär- und Sekundärliteratur
- primär: eigene Werke (Dramen, Gedichte, Gesetzestexte etc.)
- sekundär: Schriftstücke, die sich mit Primärliteratur befassen
- Beispiel: Bram Stokers “Dracula” ist ein Primärtext, ein Sachbuch über seine Auswirkungen auf das Fantasygenre gilt als Sekundärtext.
- am Ende kontrollieren, ob auch wirklich alle Buchquellen, aus denen du zitiert hast, eingetragen wurden
Es existieren noch weitere Darstellungsmöglichkeiten für Literaturverzeichnisse, welche du insbesondere im wissenschaftlichen Kontext im Internet nachschlagen kannst.
Internetquellen
Möchtest du eine Internetquelle zitieren, gilt eine zusätzliche Vorgabe. Da Internetseiten jederzeit geändert oder gelöscht werden können, musst du angeben, wann du die Quelle aufgerufen hast. Dies kann beispielsweise so aussehen:
epubli: Quellenangaben und Fußnoten richtig verwenden, https://www.epubli.com/wissen/quellenangabe (abgerufen am 01.01.2024)

Literaturverwaltungssoftware – Quellenangaben leicht gemacht
Sind dir manuelle Quellenangaben zu mühselig, kannst du auf eine Literaturverwaltungssoftware zurückgreifen. In derartige Programme speist du einmal alle Literaturquellen ausführlich ein. Bei Büchern reicht meist die Eingabe der ISBN, um das Werk in deine Literaturübersicht aufzunehmen. Zur besseren Verwaltung kannst du die Titel außerdem häufig gruppieren, mit Schlagworten versehen, Notizen hinzufügen u.v.m. Sobald dein Schreibdokument mit der Software verknüpft ist, kannst du aus einer umfangreichen Liste einen Zitierstil wählen oder einen eigenen anlegen. Mit wenigen Klicks kannst du anschließend die gewünschten Quellen in das Dokument einfügen. Das Literaturverzeichnis wird dabei automatisch für dich angelegt. Entscheidest du dich zu einem späteren Zeitpunkt für eine andere Belegweise für deine Quellen, änder einfach deine Voreinstellungen. Alle bisherigen Quellenangaben und Literaturverzeichnisse werden automatisch dem neuen Stil angepasst.
Zu den bekannten Literaturverwaltungsprogrammen zählen unter anderen Citavi, EndNote und Zotero. Einen aktuellen und umfangreichen Vergleich dieser und weiterer Software bietet die Technische Universität München. So findest du die passende Literaturverwaltungssoftware für deine Bedürfnisse als Autor oder Autorin.
Sachbuch schreiben - jetzt Whitepaper sichern
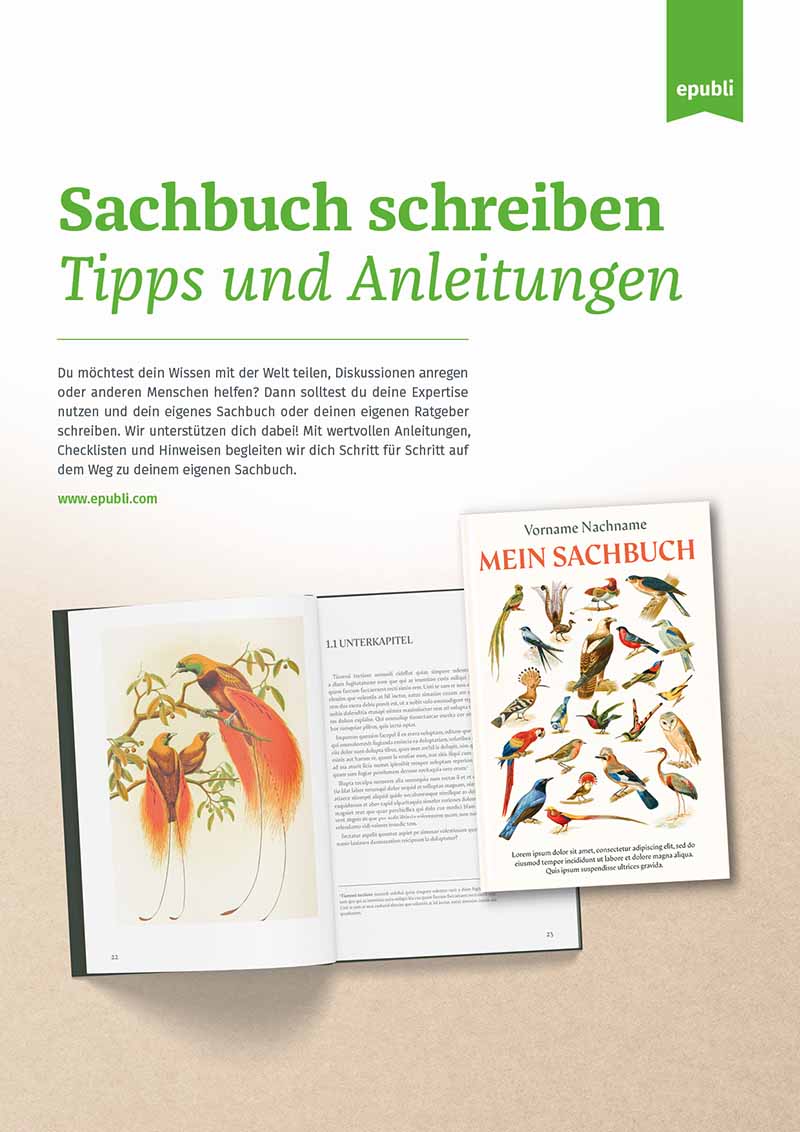
Du bist Expert*in auf einem Gebiet und möchtest ein eigenes Sachbuch schreiben? In diesem Whitepaper erklären wir dir auf 18 Seiten, wie du dein Wissen in einem Sachbuch aufbereitest, um es mit deiner Zielgruppe zu teilen. Lerne:
- welche Gründe dafür sprechen, ein Sachbuch zu schreiben
- wie du deine Zielgruppe findest
- wie du in 3 Schritten die perfekte Struktur erhältst
- wie du Quellen korrekt angibst
- welcher Sprachstil zu deinem Thema passt
- wie du deinen Text in 7 Schritten überarbeitest
- wie du ChatGPT für dein Sachbuch nutzen kannst
- wie du dein Sachbuch veröffentlichst & vermarktest